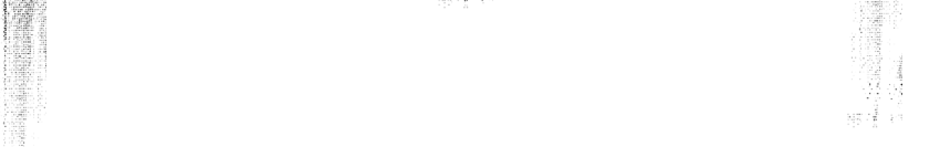Publikationen von Norbert Giovannini
Dank langjähriger Kontakte zur Enkelin des jüdischen Volksschullehrers Hermann Durlacher und seiner Frau Martha verfügen wir über Briefe des Ehepaars an die in England und Canada lebenden Söhne, die im Sommer 1939 noch knapp mit einem Kindertransport aus Deutschland entkommen konnten. Die Eltern schreiben aus dem Lager Gurs. Ihre Lage ist dramatisch. Emigrationspläne haben sich zerschlagen. Die gesundheitliche Situation von Martha Durlacher verschlechtert sich zusehends, Hermann Durlacher muss harte Zwangsarbeit leiste. Die Söhne können den Eltern nicht wirksam helfen. Ein Brief voller versteckter Hinweise auf die Lebenssituation vom Frühjahr 1939 aus Heidelberg an einen Verwandten ergänzt die kommentierte Dokumentation der Durlacher-Briefe.
Zum Artikel:
Durlachers Briefe.pdf
PDF-Dokument [1.5 MB]
Angeregt durch einen Besuch der in Großbritannien lebenden Nachkommen des jüdischen Ehepaars Klara und Alfred Baer und ihres Sohns Hans-Dieter dokumentieren wir sieben Briefe der Mutter an die englischen Pflegeeltern ihrer Kinder, die zwischen November 1938 und Juni 1939 geschrieben wurden. Nach der Pogromnacht am 9. November 1938 unternahmen die Baers alles, um ihre beiden Kinder mit einem Kindertransport nach England in Sicherheit zu bringen. Die Briefe bringen Schmerz, Angst und Hoffnung der Eltern, Vertrauen in die Hilfe der englischen Pflegefamilie und Freude über das „gute Ankommen“ des Sohns zum Ausdruck. Ein Wiedersehen gab es nicht: Die Eltern wurden 1940 nach Gurs transportiert, der Vater starb in einem französischen Lager, die Mutter wurde in Auschwitz getötet.
Briefwechsel Baer.pdf
PDF-Dokument [997.7 KB]
Ehrung eines Lebenswerks
40 Jahre zu jüdischer Stadtgeschichte geforscht: Obermayer-Preis für Volker Keller
Von Norbert Giovannini
Es gibt viele Orte in Mannheim, an denen man Volker Keller treffen könnte. Der frühere Lehrer und – bis 2017 – Rektor der Mozartschule in R 2 ist ein Urgestein der Stadtgeschichtsforschung mit einem ausgeprägten Schwerpunkt auf die jüdische Geschichte Mannheims. Man könnte ihn antreffen an dem ästhetisch eindrucksvollen gläsernen Kubus auf den Planken, an dessen Wänden die Namen der über 2000 aus Mannheim deportierten Juden verzeichnet sind. Ein Projekt, das zurückgeht auf eine Jugendgruppe, mit der Keller um 1995 eine Liste der jüdischen NS-Opfer erstellt hatte.
Oder auf dem jüdischen Friedhof und in den Quadraten, die Volker Keller unzählige Male mit Gästen und Einheimischen begangen hat, um die frühere wie die gegenwärtige Geschichte von Südwestdeutschlands größer jüdischer Gemeinde zu zeigen. In B 7, 3 würde zur Gedenktafel „Jüdisches Altersheim und Mikwe 1939-1942“ führen. Oder am Bismarckplatz, wo Volker Keller eine Gedenkstele für das „Judenhaus Große Metzelstraße 7“ initiierte. Die Metzelstraße ist schon in den 1960er-Jahren der Stadtsanierung zum Opfer gefallen, so auch das Haus von Erwin und Flora Heilbronner, die mit ihren Söhnen im Oktober 1940 ins Lager Gurs in den Pyrenäen deportiert wurden. Im Beisein der überlebenden Familienangehörigen wurde 2014 den Bewohnern des Hauses gedacht.
Anlass für die Nachkommen, die heute in der US-Metropole Seattle und im israelischen Beer Sheba leben, sich für eine Ehrung durch die amerikanische Obermayer-Foundation zu engagieren. Mit Erfolg: Im Januar ist Volker Keller mit fünf anderen Preisträgern in einer virtuellen Feier mit dem Obermayer-Award ausgezeichnet worden. Die Obermayer-Stiftung ehrt seit über 20 Jahren Aktive der Erinnerungs- und Gedenkarbeit in ganz Deutschland für ihr Engagement. Unter dem Titel „Widen the Circle“ (zu Deutsch: den Kreis erweitern) hat Joel Obermayer, Sohn des Gründerehepaars, eine Ausweitung vorgenommen. Gewürdigt werden Initiativen, die gegen Rassismus, rechten Radikalismus, Hass und Antisemitismus ankämpfen, hier in Deutschland wie auch in den USA, wo die Gedenkarbeit an Sklaverei, Lynchjustiz und brutale rassistische Praktiken im Zentrum steht. Maßgeblich für die Stiftung ist das gesellschaftliche Wirken der Preisträger, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Kontakten mit ehemaligen jüdischen Einwohnern, Gedenkstätten und künstlerischen Projekten.
Kein Zweifel, dass Volker Keller all dies eindrucksvoll verkörpert. Wo immer es um Mannheimer Stadtgeschichte geht, ist der 67-Jährige seit 40 Jahren präsent: als Autor zahlreicher Bücher und Artikel, als Stadtführer und Vortragender, vor allem aber als unermüdlicher Sucher und Forscher. Bekannt sind seine Studien zum jüdischen Leben in Mannheim (1988 und 1995), zur Mannheimer Klaus, dem Lehrhaus und der Synagoge der orthodoxen Gemeinde, (2012) und dem jüdischen Friedhof (Bet Olam, 2017).
Dass er nebenbei die Industrie- und Gewerbegeschichte sowie die Baugeschichte zahlreicher Häuser und öffentlicher Bauten rekonstruiert und in Bild und Wort brillant dokumentiert hat, beschreibt die Reichweite seines Engagements. Für viele Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Forschende ist er seit Jahrzehnten der Ansprechpartner schlechthin, wenn es um Mannheims Geschichte geht. Nicht minder für die Jüdische Gemeinde, den Altertumsverein und zahlreiche städtische Initiativen.
Sein jüngstes Projekt ist die Rekonstruktion der ostjüdischen Zuwanderung nach Mannheim. Ein Riesenkapitel, das akribische und beharrliche Forschung erfordert. Bei dieser Arbeit kann man ihn auch zu Hause im Stadtteil Neuostheim antreffen. Volker Keller strahlt Bescheidenheit aus, wirkt zurückhaltend und nachdenklich. Was ihn antreibt, ist der Wunsch, den sonst Vergessenen eine Stimme, ein Gesicht, eine Erinnerung zu geben. Für dieses Lebenswerk ist er jetzt ausgezeichnet worden.
Rhein-Neckar-Zeitung 20.03.2021
Hans Flor
Begegnungen mit Hans Flor sind eindrucksvoll und berührend. Er ist ein Mensch, der mit großer Klarheit spricht, seine Botschaften sind unmissverständlich, unverstellt, sie treffen ins Herz. Er begeistert junge Menschen, ja solche jeden Alters. Ich kenne niemanden, der sich seiner schlichten, bescheidenen und entschiedenen Wahrhaftigkeit entziehen kann.
Ich habe Hans Flor um 2010 kennen gelernt. Mit Frank und Ingrid Moraw trug ich Biographien jüdischer Einwohner für ein Buchprojekt zusammen. Sie bahnten den Weg zu Hans Flor und überzeugten ihn, dass er eine lang gelebte Zurückhaltung und sein bewusstes Schweigen über die traumatisierenden Erfahrungen in der NS-Zeit und der Lagerhaft beenden sollte, dass er bereit wurde, seine Geschichte und die seiner Familie öffentlich, im Kontakt mit so vielen jungen Menschen und in alle Formen der Erinnerungsarbeit einzubringen. Zahlreiche Veranstaltungen folgten, in denen er – der letzte noch Lebende der Heidelberger jüdischen Bevölkerung aus der NS-Zeit – ganz unpathetisch, überaus konzentriert und voller bewegender Erinnerungen – aus seiner Familiengeschichte berichtete. Ein Schatz an Erinnerungen, die so keinen Dokumenten und keinem Archiv zu entnehmen sind.
1926 als Sohn einer jüdischen Mutter und eines kommunistisch gesinnten Vaters in Handschuhsheim geboren, durchlebte er Kindheit und Jugend in der NS-Zeit. Die Eltern standen in anhaltender Bedrohungssituation, die Mutter wurde mehrfach inhaftiert. An eine erfolgreiche Schulausbildung, an Studium war für ihn nicht zu denken. Wie sein vier Jahre älterer Bruder Alfred fand er Arbeit in einem Heidelberger Betrieb. Bruder Alfred gelang die Ausreise nach Palästina, die vor der Landung in Haifa beinah tödlich geendet wäre. Hans musste die Deportation der Großmutter, zweier Onkels und einer Tante ins Lager Gurs 1940 erleben, nur Oma Lina überlebte, die anderen wurden in Auschwitz getötet. Ihn selbst und seine Mutter traf es 1945, als sie im Februar wenige Wochen vor der Befreiung Heidelbergs durch die Amerikaner, in das Lager Theresienstadt deportiert wurden. Das Lager, die Ankunft entkräfteter Auschwitzinsassen, der tägliche Hunger und der Überlebenskampf – das prägte ihn nachhaltig, hat ihn aber nicht zerbrochen. Mit gesundem Ehrgeiz holte er die Ausbildung nach, machte erfolgreich ein Ingenieurstudium, arbeitet bei den Heidelberger Druckmaschinen und wurde schließlich technischer Manager der International Harvester, einer Traktorenfabrik in Rohrbach.
Etwas von der Nüchternheit eines Ingenieurs und Managers steckt noch in hohem Alter in ihm. Geistige Klarheit, gepaart mit eindringlicher Schilderung seiner Erfahrungen, mahnen ohne moralisieren, keiner Frage ausweichen, die Antworten präzise, der Blick wach. So habe ich ihn erlebt, so haben ihn viele erlebt, Schüler*inne, Student*innen, die Teilnehmer*innen von Gedenkveranstaltungen, wir alle im Gespräch. Er hat uns zu „Zweitzeugen“ einer Geschichte gemacht. Und wir werden sie weitertragen. Seine Geschichte und die einer ganzen grauenhaften Epoche, die in seinen Berichten aufscheint. Mit der er uns auffordert, alles zu tun, dass sie so oder anders nie mehr geschehen wird.
Norbert Giovannini
März 2021
2020
Wie der Weltuntergang seinen Autor überlebte
Heidelberger Büchermacher gestaltete Satire des in Österreich lebenden Schriftstellers Jura Soyfer - Als Einzelveröffentlichung erschienen
Von Norbert Giovannini
Wenn es schon, wie in Jura Soyfers 1936 verfasster Satire, um den Weltuntergang geht, also um ein etwas aufwändiges Geschehen, dann darf´s an dramatischem Personal nicht fehlen: Sonne, Saturn und Venus sind erforderlich, ein Weltuntergangsprediger, ein Papagei und natürlich Konrad, ein Komet, der den Untergang mit finalem Drall bewerkstelligen soll. „Nein, zur Erde. Prallt mit aller Wucht auf die Erde auf! Es bringt einen Tippel – aber an der Erschütterung gehen garantiert alle Erdmenschen zugrund!“ Wie zu erwarten tummeln sich auch die Mächtigen, die Zynischen und die Ignoranten dieser Welt auf der Bühne.
Nachzulesen ist Soyfers Satire nun als Einzelveröffentlichung, ästhetisch bestechend gestaltet vom Historiker und Büchermacher Florian Schmidgall aus Heidelberg.
Bei aller kosmischen Harmonie, auf der Erde läuft was aus dem Ruder, „irgendeine ekelhafte Dissonanz“. Zur fachkundigen Beratung konsultiert die Sonne ausgerechnet den charmant-wienernden Erdmond. „Was machen die Sonnenfleckerln, die peinlichen? Ja, ja, man wird alt“. Der berichtet von den wahren Urhebern der Dissonanz, den Menschen. Flink beschließt die Sonne, einen nach seinem Sternschnupperl süchtigen Kometen zum „Tschin-bum-krach“ auf die Erde zu schicken, um den „widerlichen Tierchen“ ein Ende zu machen. Schlechte Nachrichten für die da unten.
Die trumpianische Führerfigur dort wittert instinktiv eine jüdisch-marxistische Weltverschwörung; Politiker verharren im Verhandlungsmodus, gerade noch besorgt um Wahlkreis und Golfplatz; Beamte ignorieren nach Dienstplan, was Weltretter Prof. Gluck wie sauer Bier anbietet. „Lassens Eahna die Erfindung gschwind patentieren!“ Streckenweise liest sich das wie eine Parodie auf aktuelle Fake-News-Produzenten: „Falsch ist falsch und wahr ist wahr, spricht der Narr. Wahr ist, was die Kurse stützt, falsch, was keiner Aktie nützt… Falsch ist wahr zu guter Letzt. Wer die Wahrheit höher schätzt, wird matt gesetzt!“
Soyfer beherrscht den frech-lakonischen Sound des politischen Kabaretts der zwanziger und dreißiger Jahre: „Erstens kann uns eh nix gschehen, zweitens ist das Untergehen ’s einzige, was der kleine Mann heutzutag sich leisten kann.“
Alles aber kein wirklicher Grund zu Panik. Ein literarischer Genieblitz Soyfers rettet die Welt. Mehr verraten wir nicht. Ein Auswendiglernen schon wert ist Soyfers finales Gedicht auf die Erde und ihre gerade-nochmal Rettung.
Zwei hilfreiche Seiten zur Worterklärung für Nicht-Österreicher und zwei richtig gescheite Nachworte beschließen das Kabarettjuwel. Von Marie-Luise Hiesinger erfahren wir von der Premiere 1936 im kulturellen Gegenmilieu des Wiener Kabaretts ABC - inmitten des grassierenden Austrofaschismus. Sie weist auch hin auf Soyfers Bezug auf Karl Kraus` monumentalem Erste-Weltkrieg-Epos „Die letzten Tage der Menschheit“ , seine eigenen, kommunistisch geprägten Zukunftsvisionen, und seine unverkennbare Prägung durch das Alt-Wiener Volkstheater des Johann Nepomuk Nestroy. Soyfers Text strotzt von Sprachwitz und anspielungsreichen Miniaturen; zu den treffsichersten Wortschöpfungen gehören „das Angravitieren, das Protuberanzl und der Reichswärmeleiter“. Herbert Arlt, der Vorsitzender der Jura Soyfer Gesellschaft in Wien, berichtet von der Wirkungs- und Editionsgeschichte dieses und zahlreicher anderen Soyfer-Texte, deren Herausgabe er sich seit langem widmet.
Jura Soyfer, 1912 im damals russischen Charkow (heute Ukraine) geboren und 1920 mit den Eltern nach Wien geflohen, war Prototyp des linken Agit-Prop-Künstlers, Zeitkritikers und literarischen Satirikers. Nach dem „Anschluss“ Oesterreichs durch Nazi-Deutschland versuchte er zu fliehen, wurde im März 1938 an der Schweizer Grenze aufgegriffen und ins KZ Dachau eingeliefert. Ein Jahr später starb er 26jährig im KZ Buchenwald an Typus. Als Jude, radikaler Linker und kompromissloser Satiriker war er dreifach in Gefahr. Sein „Weltuntergang“ aber hat ihn überlebt.
Info: Jura Soyfer: "Der Weltuntergang".
Herausgegeben von Florian Schmidgall.
Kurpfälzischer Verlag Heidelberg.
Rhein-Neckar Zeitung, 4. Dezember 2020
Wie der Nazi-Terror auch in Heidelberg eskalierte
Von der Pogromnacht 1938 bis zur Deportation nach Gurs im Oktober 1940
Von Norbert Giovannini
Für 299 Heidelbergerinnen und Heidelberger begann am 22. Oktober 1940 ein Martyrium, das für zwei Drittel von ihnen im Lager Gurs, in Auschwitz und anderen Tötungslagern endete. Seit 1933 waren Juden und andere Verfolgte permanentem Terror ausgesetzt, einer Gewaltspirale, deren Höhepunkt das infam inszenierte Pogrom der „Kristallnacht“ im November 1938 war. Nach diesem Gewaltexzess eskalierte der Terror bis 1940 und weiter bis Kriegsende durch Deportation und eiskalte Verwaltungsmaßnahmen. Mit Perfidie bemächtigten sich Staat, NS-Partei und zahllose Nutznießer des Vermögens, der Lebensgrundlagen und schließlich der puren Existenz der jüdischen Menschen. Dem sah die jüdische Bevölkerung nicht tatenlos zu: Mit enormen Anstrengungen wurden Flucht, Ausreise und Hilfen organisiert sowie der Isolation und Verarmung vor Ort entgegengewirkt.
Zunächst wurden „die Juden“ durch eine „Judenbuße“ gezwungen, die Schäden der Pogromnacht zu bezahlen. Die „Reichsvermögensabgabe“ erbrachte 1939 über eine Milliarde Reichsmark. In Heidelberg zahlte die jüdische Gemeinde das Wegräumen der Synagogentrümmer in der Lauerstraße. Im Frühjahr und Sommer 1939 mussten Schmuck, Silber und Gold, sowie Uhren, Ringe und Besteck im städtischen Leihamt abgegeben werden. Eine dreiste Raubaktion, von der nur Eheringe ausgenommen waren. Die Gegenstände wurden an Heidelberger Goldschmiede und Juweliere versteigert. Nach dem Krieg war nichts mehr davon vorhanden.
Es folgte der Griff nach jeder Art von Geldvermögen, das auf Sperrkonten festgefroren wurde. Wertpapiere wurden eingezogen oder mit extremen Steuern belegt. Die prekäre Lage von Geschäften und Betrieben wurde im Zuge der „Arisierungen“ genutzt, den Zwangsverkauf von Wohnungen, Gewerberäumen und Firmen zu beschleunigen. Geschädigt durch Käuferboykotte und dringend auf Geldmittel zur Flucht angewiesen, liquidierten jüdische Inhaber ihre Betriebe, verkauften Immobilien unter extremem Wertverlust, allein 1938 in Heidelberg 49 Geschäfte und Betriebe. Ab Dezember 1938 folgten die letzten Geschäfte, wie die florierende Tabakfabrik Hochherr, das Modegeschäft Maxelo in der Hauptstraße und Bäcker Seligmann in der Plöck.
Geradezu obszön gestaltete sich der Verlauf, wenn die neuen Besitzer versuchten, den Preis zu drücken. So im Fall zweier Grundstücke am Wilhelmsplatz, die plötzlich weniger wert sein sollten, weil das Geläut der Bonifatiuskirche, HJ-Aufmärsche und der Wochenmarkt Lärm verursachten.
Bei Flucht und Ausreise kassierte der Fiskus erbarmungslos durch die Reichsfluchtsteuer und Devisenabgabe. Selbst Kleinigkeiten wie eine zweite Garnitur Bettwäsche, die Hildegard Basnitzki in die Schweiz mitnehmen wollte, musste gesondert bezahlt werden.
1939 versuchten jüdische Eltern verzweifelt, ihre Kinder mit Kindertransporten nach England zu
schaffen. Bei 37 Heidelberger Kindern gelang es, verbunden mit der schmerzhaften und meist endgültigen Trennung von ihren Eltern. Ein Foto und ein Spielzeug durften sie mitnehmen, sonst nichts. Unter ihnen waren auch die Söhne von Lehrer Hermann Durlacher und seiner Frau Martha. Durlacher hatte nach seiner Haft in Dachau den Unterricht der jüdischen Kinder in der Bunsenstraße fortgesetzt, bis wenige Tage vor der Deportation, bei der er und seine Frau mitsamt 13 seiner Schüler verschleppt wurden, acht von ihnen mit den Eltern. 1942 wurden die Durlachers nach Auschwitz deportiert, ebenso sieben der Schüler. 16 von Durlachers Schülern wurden 1939 durch die Kindertransporte nach England gerettet.
Dramatisch änderte sich die Wohnlage: Jüdischen Mietern wurde ohne Begründung gekündigt, von der Stadt wurden sie in „Judenhäusern“ zusammengepfercht. In der Landfriedstraße 12, der Häusserstraße 4, der Bunsenstraße 19a und weiteren 13 Häusern sammelten sich verzweifelte Menschen, unter totaler Kontrolle der Gestapo. Zugleich boten die Häuser ihren 274 Bewohnern Schutz, Solidarität und Alltagshilfe. 183 von ihnen wurden aus den Häusern 1940 und danach deportiert. Mit Hingabe half der jüdische Gemeindevorstand unter Sally Goldscheider wo immer möglich; gemeindeeigene Vereine hielten Ausbildung, kulturelles und sportliches, soziales Miteinander aufrecht
In den letzten Jahren wurde immer mehr zu Hilfsnetzwerken und Einzelhilfen nichtjüdischer Heidelberger recherchiert. Frieda Müller in Ziegelhausen, die die Familie Herzberg unterbrachte, das Ehepaar Winterroll, das den Mannheimer Cahn-Garnier beherbergte, Emil Henk, bei dem Gertrud Jaspers unterkam. Dazu natürlich der unermüdliche Pfarrer Hermann Maas und sein Unterstützerkreis, die Ärztin Marie Clauss und die Sozialarbeiterin Therese Wiesert, die beide nun im Hospital-Gelände in Rohrbach durch Straßennamen gewürdigt werden sollen.
Im Oktober 1940 wurden 299 Menschen aus Heidelberg deportiert, etwa 70 überlebten Gurs und andere Lager, 54 konnten aus Gurs emigrieren, 40 davon in die USA. Bis 1945 gab es weitere sechs Deportationen nach Riga, Izbica, Auschwitz und Theresienstadt. Mit Akribie wurden die Listen der noch vor Ort Wohnenden „abgearbeitet“, zuletzt auch die jüdischen Partner aus „Mischehen“. 15 der Deportierten kehrten ab 1945 nach Heidelberg zurück, darunter die langjährige Vorsitzende der Nachkriegsgemeinde Rositta Oppenheimer und der Altstadtantiquar Albert Carlebach. Daten und Zahlen können allerdings kaum das Leid, die Verzweiflung und die alles beherrschende Furcht mitteilen, die das Leben in diesen Jahren bestimmten.
In größter Verzweiflung nahmen sich 16 Heidelbergerinnen und Heidelberger, darunter Leontine Goldschmidt und die Lehrerin Erika Pringsauf, das Leben. In dem Buch „Stille Helfer“ wird auch an Arthur Strauss, Rechtsanwalt und in „Mischehe“ verheiratet, erinnert, der bis 1945 als Kontaktmann zwischen NS- und Stadtbehörden und den jüdischen Einwohnern beschäftigt wurde. Ein Tröster, ein Helfer, selbst schwer belastet, mit seiner Frau inhaftiert, Überbringer schlimmer Botschaften. Nach 1945 hat er unermüdlich Entschädigungsfälle vorangetrieben und die Portheim-Stiftung gerettet.
Rhein-Neckar Zeitung, 22. Oktober 2020
2019
2018
Auch durch Heidelberg fegte eine Orgie der Gewalt
Die Synagoge in der Altstadt wurde in der Nacht zum 10. November 1938 angezündet – Über 70 Juden kamen in Konzentrationslager
Von Norbert Giovannini
Am Vormittag des 10. November 1938 kommt Rudolf Lampert an seinen Arbeitsplatz, das Büro des Möbelfabrikanten Gustav Basnizki in der Kaiserstraße 6 (Weststadt). Gegen 7 Uhr dringen sechs bis acht SA-Männer vom Wilhelmsplatz kommend in die drei Büroräume ein. Basnizki und seine Frau, die in einem kleinen Nebenzimmer wohnen, flüchten in den Dachstuhl. Eine Orgie der Gewalt fegt durch die Büros. Lampert berichtet: „Die beiden großen und der kleine Perserteppich waren an vielen Stellen mit SA-Dolchen zerschnitten und außerdem mit Tinte beschüttet worden. Der Schreibtisch stand auf dem Kopf, die Schubladen waren herausgerissen und zertrümmert (...) Die vier ledernen Klubsessel waren mit SA-Dolchen zerschnitten worden (...) Die großen Aktenregale wurden auseinandergesprengt und dadurch unbrauchbar gemacht. Das Gemälde ,Große Landschaft’ von Prof. Schönleber lag auf dem Fußboden und war zertreten.“ Die SAler machen eine Pause. Gustav und Ernestine Basnizki flüchten. Basnizki bricht auf der Straße zusammen. Mehrere Wochen liegt er im St. Josefskrankenhaus, bis er mit seiner Frau in die Schweiz ausreisen kann. Rudolf Lampert erinnert sich an einen Besuch bei seinem Chef im Krankenhaus: „Ich musste feststellen, dass er körperlich völlig zusammengebrochen war und kaum etwas mit mir sprechen konnte. Vorher war er immer völlig gesund.“ Man spürt im Protokoll, aufgefunden in einer Entschädigungsakte von 1951, das Entsetzen des Zeugen vor der Zerstörungslust, dem unverhohlenen Sadismus.
In der ganzen Stadt toben sich marodierende SA-Horden, ein SS-Trupp, ein paar gewaltgierige Mitmacher aus, die einen vom Wredeplatz (heute: Friedrich-Ebert-Platz) aus, die anderen vom Wilhelmsplatz. Die Pogromnacht war lange vorbereitet in der Nacht vom 9. auf den 10. November inszeniert worden, ausgelöst durch Goebbels-Rede in München, wo sich die NS- und SA-Granden im Gedenken an den Putschversuch von 1923 versammelt hatten. Die NS-Presse hatte drei Tage lang das Attentat eines jüdischen Jugendlichen, dessen Eltern nach Polen deportiert wurden, auf Botschaftssekretär Ernst vom Rath in Paris als „Kriegserklärung des internationalen Judentums“ hochgepuscht. Dem sollte nun der Dampfhammer einer wilden Zerstörungsjagd antworten. 1406 Synagogen, Betstuben und Gemeinderäume, Tausende von Wohnungen, Geschäften, Anwaltskanzleien und Arztpraxen wurden reichsweit gestürmt. Mindestens 400 Todesopfer, darunter viele Suizide, waren unmittelbar zu beklagen, ebenso viele Häftlinge starben in Lagern, bei der Flucht und durch Misshandlungen.
Obersturmbannführer Hans Bender von der SA-Standarte 110 hatte gegen 1 Uhr den Leiter des SA-Studentensturms Franz von Chelius beauftragt, die Synagoge in der Lauerstraße in Brand zu stecken. Dies geschah zwischen 2 und 3 Uhr, nachdem die Geheime Staatspolizei Kultgegenstände und Papiere aus der Synagoge transportiert hatte. Die Feuerwehr, die um 4.45 Uhr erschien, durfte nur das Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser verhindern. In den frühen Morgenstunden lagen Rauchschwaden über der Altstadt, das Synagogendach war eingestürzt. Angegriffen wurden auch das Bethaus der orthodoxen Gemeinde (Plöck 35) und die Rohrbacher Synagoge, wohin Chelius weitergezogen war. Mit dem SA-Pioniersturm unter Philipp Maßholder wurden dort die Eingangstür und die Einrichtung zertrümmert, mit Büchern und Akten zum Scheiterhaufen aufgeschichtet und angezündet.
Demoliert und geplündert wurden mindestens 17 Geschäfte in der Altstadt, in Bergheim und der Weststadt, die Kanzleien aller jüdischen Anwälte, die Praxis des einzigen verbliebenen jüdischen Arztes in der Bunsenstraße 3 und zwischen 15 und 20 Privatwohnungen. Allein in der Hauptstraße traf es das Bettengeschäft Sommer (Hausnummer 80), die Teigwarenfabrik Beer-Gutmann (Nr. 64), das Textiliengeschäft von Heinrich und Max Kaufmann (Nr. 87) und die Möbelfabrik Reis (Nr. 79). Demoliert wurde auch die Wohnung des Kantors Julius Krämer (Untere Neckarstraße 54) sowie Wohnung und Laden des Tuchhändlers Kahn in der Bunsenstraße 7.
Zerstört wurde das Zimmer der jüdischen Klasse in der Landhausschule. In ihr, damals Pestalozzischule, hatte Lehrer Durlacher seit 1935 die jüdischen, aus der Volksschulen ausgegliederten Kinder unterrichtet. Das „arische“ Lehrerkollegium bekundete nun, dass ein weiteres Zusammensein mit den jüdischen Schülern im Haus nicht mehr zumutbar war.
Mindestens 73 jüdische Männer aus Heidelberg wurden von Gestapo und Polizei verhaftet und in den Faulen Pelz, das Stadtgefängnis, transportiert. Tags darauf folgte der Transport in die Lager Buchenwald, Sachsenhausen und – aus Heidelberg – nach Dachau. Es waren über 30 000 Männer, die dort wochenlang dem gnadenlosen Terror ausgesetzt blieben: stundenlanges Stehen, sinnlose Schwerstarbeit, demütigende Rituale, Schläge und Strafen. Wer entlassen wurde, musste sich verpflichten, Deutschland schleunigst zu verlassen.
In sechs Fällen gingen die Söhne anstelle älterer Väter ins Lager. Gymnasialprofessor Ludwig Basnizki verwies auf seine schwere, noch sichtbare Kriegsverletzung und das Eiserne Kreuz, das er als Frontkämpfer erhalten hatte. Der Tabakhändler Richard Marx wurde von einem Polizisten zu Hause abgeholt, der ihn zu Fuß zum Bahnhof begleitete. Als sie ankamen, war der Zug nach Dachau fort, der Polizist schickte Marx wieder nach Hause. Sally Goldscheider, der Gemeindevorsitzende, wurde gleich entlassen und kehrte in das Inferno zurück, das die SA in seiner Weststadtvilla hinterlassen hatte.
Völlig passiv blieb in Heidelberg das Rathaus. Von dort kam nie Hilfe für die Juden und andere Verfolgte, allenfalls in unberechenbaren Einzelfällen. Wenn es Klagen gab, dann über die volkswirtschaftlich unsinnige Zerstörung von Sachwerten“ (Hermann Göring), die sich das Reich gerne legal und unbeschädigt angeeignet hätte. Goebbels Lösung war dagegen einfach. Die Schäden solle „der Jude“ bezahlen. Tatsächlich mussten die jüdischen Gemeinden die Kosten der Trümmerbeseitigung der Synagogen übernehmen. Von den deutschen Juden wurde eine Sonderabgabe von über einer Milliarde Reichsmark eingetrieben. In der Bevölkerung regte sich Irritation und Abscheu. Mitleid, kleine Zeichen von Solidarität, Hilfen zur Flucht sind bezeugt, aber es dominierten Angst, Gleichgültigkeit und Opportunismus.
Auffällig in Heidelberg ist auch, dass die örtliche Parteileitung in die Pogromaktion nicht einbezogen war. Nach Goebbels Anweisung sollte „die Partei“ nach außen hin nicht die Regie führen. Wichtigtuerisch lässt sich der Kreisleiter am Vormittag des 10. November im Dienstwagen in die Altstadt, nach Rohrbach, ja bis nach Wiesloch und Walldorf kutschieren, wo andere schon vollendete Tatsachen geschaffen haben. Am Nachmittag sucht er seinen Mannheimer Friseur auf, während weitere SA-Trupps marodierend durch die Stadt ziehen. Am Abend des 10. November wurde das Pogrom amtlich beendet.
Die Folgen: Nahezu alle Geschäfte und Betriebe von Juden wurden in den folgenden Wochen liquidiert oder „arisiert“, also zu lächerlichen Preisen zwangsverkauft. Geldkonten eingefroren, Wertpapiere eingezogen und verkauft. Gold, Silber und Schmuck mussten bis August 1939 beim städtischen Leihamt abgegeben werden, die Edelmetalle wurden eingeschmolzen, der Schmuck an lokale Händler versteigert. Der Vermögensraub und die Reichsfluchtsteuer bewirkten, dass die nun einsetzende Flucht ins Ausland mit weitgehender Verarmung zusammenfiel. Mietverhältnisse mit Juden konnten gekündigt werden, in Heidelberg entstanden Judenhäuser in „jüdischen“ Immobilien. Das kleine Bethaus in der Plöck, eigentlich eher eine Wohnung, wurde zur Stätte der Gottesdienste.
40 der 73 Heidelberger Dachau-Häftlinge konnten (meist mit Ehefrauen und Kindern) 1939 ins Exil fliehen, zehn nach Großbritannien, 18 in die USA, fünf nach Palästina und sieben nach Südamerika. Zwölf der Inhaftierten starben später in Gurs, neun in Auschwitz und vier gelang die Flucht aus Gurs in die USA. Am 27. Dezember 1938, sieben Tage nach seiner Rückkehr aus Dachau, verstarb der Kaufmann Michael Liebhold an den Folgen schwerer Misshandlungen.
Heidelberger Nachrichten vom Freitag, 9. November 2018,
Seite 3
„Unsere ganze friedliche Stimmung hatte sich so plötzlich in Luft aufgelöst“
Ein fast völlig vergessenes Kapitel der Judenverfolgung: Die Polendeportation am 28. Oktober 1938 traf auch Heidelberger Familien – Von Norbert Giovannini
„Ich erinnere mich noch genau: Es war Donnerstagabend gegen 19 oder 20 Uhr, als mein lieber Vater gerade frisch gebackene kleine Neckarfische aß, die meine liebe Mutter so appetitlich zubereitete. Plötzlich klopfte es an unserer Haustür und zwei Gestapobeamte standen da; sie baten meinen Vater, mitzugehen. Weder ihm noch uns nannten sie den Grund der Festnahme oder das Ziel des Abtransports. Unsere ganze friedliche Stimmung hatte sich so plötzlich in Luft aufgelöst.“
Die damals neunjährige Emma Sipper beschreibt den Abend des 28. Oktober. Sie ist eine der Töchter von Oskar und Salla Sipper, einer Neuenheimer Familie, die in der Schröderstraße 25 Möbel verkaufte und versteigerte. Das Ereignis, das ihr noch nach Jahrzehnten in den Knochen steckt, ist die Polendeportation 1938. 13 Tage vor der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November, die sich so wirkungsmächtig in das Gedächtnis von Zeitgenossen und Nachkommen eingeprägt hat. Die Ausweisung und Deportation von 17 000 polnischen Juden an die Grenze zu Polen ist dagegen kaum mehr präsent.
Die sogenannten Ostjuden wurden von fast allen geächtet
Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert flohen russische und polnische Juden vor Pogromen und Armut, vor Verfolgung und Judenhass nach Westeuropa und versuchten ihr Glück im Exil. Sie waren „ungebetene Gäste“, denen auch der liberale badische Staat notorisch die Einbürgerung verweigerte. Beschimpft und geächtet als Ostjuden, als Schtetl-Juden, hatten sie es doppelt schwer. Denn auch die liberale angestammte jüdische Gemeinschaft hielt Distanz. Sie waren traditionell und fromm, blieben unter sich und waren in Maßen integriert. Zugleich waren sie Opfer der gehässigen, antijüdischen Stereotypen. Wie auch in Österreich – vor und nach dem Ersten Weltkrieg – schlug ihnen Verachtung und unverhohlener Hass entgegen.
Im praktischen Leben waren sie tüchtig und kaufmännisch geschickt. Ihre Second-Hand-Geschäfte waren im Krieg, der Inflationszeit und der Weltwirtschaftskrise ein Segen für die weniger betuchte Bevölkerung. Preisgünstige Textilien, Möbel- und Lebensmittel waren Schwerpunkte ihrer Angebote. In der Heidelberger Altstadt, der Unteren Straße, aber auch in Neuenheim, Bergheim und Rohrbach boten „die Polnischen“ Ware zu günstigen Preisen an und hatten einen guten Namen. „Einen Laden wie die Rubinsteins hätte man haben sollen“, bekundete der Feuerwerker Kesselbach aus der Unteren Straße über seine Nachbarn, die Rubinsteins.
Seit der Jahrhundertwende hatten sich polnische Juden hier niedergelassen: die Geffners, Gottfrieds, Liebmanns, Rubinsteins und Weiners. Verwandtschaftlich eng verbunden, Geschwister und Verwandte vor allem aus den Gebieten der Bukowina, der heutigen Ukraine und aus dem 1919 wieder neu entstandenen Polen. Die Familienbilder zeigen stolze und selbstbewusste Menschen, ein mäßiger, aber solider Wohlstand ist Standard, nichts von Trödel- und Betteljuden. Die Kinder erhalten eine gute Ausbildung, besuchen die mittlere und höhere Schule, zuhause steht ein Klavier, und man bezahlt einen Lehrer, der Religionsunterricht gibt.
Die meisten blieben polnisch ohne Chance auf Einbürgerung, wenn sie nicht gar in den allerunglücklichsten Status der Staatenlosen gestoßen wurden. Seit 1933 war ihre Lage mehr und mehr prekär geworden. Schikanen und wirtschaftlicher Druck wuchsen. Kunden trauten sich nicht ins Geschäft. Mehr und mehr zehrte man von der Substanz. Über 100 Angehörige der polnisch-jüdischen Einwohner Heidelbergs ergriffen von 1933 bis 1938 die Flucht. Deutlicher als die mit Deutschland überstark identifizierten großbürgerlichen Juden spürten sie die Gefahr und Bedrohung, die in ihren kollektiven Biografien eingeschrieben waren. Flucht hieß damals wie heute, nahezu alles zurückzulassen – die Geschäfte, die Wohnungen, die man schnell und unter Wert verkaufen musste. Den Hausrat in Container gepackt, die selten ihr Ziel erreichten. Dazu ruinöse Steuern und Abgaben, die vollends in die Armut führten. Mehr als die Hälfte floh in die USA, unter ihnen zahlreiche Angehörige der Familien Weiner aus der Plöck, die Geffners und Liebmanns aus der Unteren Straße und die Gottfrieds aus der Hauptstraße. Elf anderen Angehörigen der Weiners, den Simons und Grisaks, gelang die Ausreise nach Palästina.
Dramatisch wurde es 1938, nach dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs. Brutale antisemitische Attacken trieben dort Unzählige in die Flucht. Aber wohin? Die polnische Regierung wollte unbedingt die „Heimkehr“ abertausender verarmter polnischer Juden verhindern. Im Oktober 1938 verlangte sie, dass sich alle Auslandspolen auf den Konsulaten melden mussten. Wer keinen Eintrag in den Pass bekam, dem sollte Polen verschlossen bleiben, ja sogar die Staatsangehörigkeit entzogen werden. Die Berliner Regierung reagierte sofort. Diesen „Klumpen von 40 bis 50 000 staatenlosen ehemaligen polnischen Juden“, wie es Staatssekretär Ernst von Weizsäcker ausdrückte, wollte man sofort loswerden. Ende Oktober ließen die beiden obersten SS-Führer Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich kurzerhand 17 000 polnische Männer, Frauen und Kinder an die Grenze zu Polen schaffen. Bei Zbaszyn (Bentschen), Chojnice (Konitz) in Pommern und Beuthen in Oberschlesien sammelten sich die verzweifelten Menschen, versuchten, ins polnische Inland zu gelangen. 8000 von ihnen mussten tage- und wochenlang unter desaströsen Bedingungen ausharren.
Aus Heidelberg (wie aus ganz Baden) wurden überwiegend „nur“ die Männer deportiert, 37 Personen, darunter auch Vater und Sohn Rubinstein aus der Unteren Straße 31, der Möbelhändler Oskar Sipper aus Neuenheim, Rebekka und Heinrich Reinhold, die ein Textilgeschäft in der Dreikönigstraße hatten. Im Jahr darauf folgten Salla Sipper, Feiga Rubinstein und die Storchs aus Rohrbach.
Einige der Männer waren kurzzeitig zurückgekehrt, um Wohnung und Hausrat zu verkaufen. So auch der Möbelhändler Sipper, der als gebrochener Mann nach Hause kam. Die Sippers ließen vor der endgültigen Ausreise zwei der Kinder, Emma und Hermann, bei einer befreundeten Familie zurück, bis diese mit einem Kindertransport nach England reisen konnten. Ein bedrückender, tränenreicher und hoffnungsloser Abschied. In England dann noch Briefe der Eltern, voller Wiedersehenshoffnung. Den letzten 1942. Danach nichts mehr.
Auseinandergerissen wurden auch Bertha Brenner und ihre Töchter. Die 1905 geborene Lilli entkam nach England, ebenso ihre 1909 geborene Schwester Malja. Bertha und die Töchter Lora und Marie wurden im Oktober 1938 ausgewiesen und im Sommer 1942 erschossen. Hilde Brenner zog 1936 nach Mannheim um; sie wurde von dort 1940 nach Gurs und im August 1942 nach Auschwitz deportiert.
Nicht allen gelang die rettende Flucht
Am 10. November 1938, einen Tag nach der Pogromnacht, wurden in Heidelberg Wohnung und Geschäft der Rubinsteins verwüstet. Ebenso der gegenüberliegende Laden der schon geflohenen Geffners. Im August reiste Frau Rubinstein alleine nach Polen, fand Mann und Sohn und flüchtete mit ihnen kurz vor Kriegsausbruch nach Rumänien. Von dort gelangten sie in einer schier endlosen Flucht über Istanbul nach Palästina. Berl Rubinstein erlitt einen Schlaganfall und wurde von Frau und Sohn buchstäblich auf dem Rücken in die Freiheit geschleppt. Kurz nach der Ankunft in Palästina ist er einem zweiten Schlaganfall erlegen.
Hier geblieben waren alle jene, die am 28. Oktober nicht erfasst wurden. Sie erlebten die Wucht der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November.
Im Oktober 1940 wurden aus Heidelberg weitere 16 polnische oder staatenlose Juden in das Lager Gurs in Südfrankreich deportiert. Unter ihnen Salomon Goldscheider, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, die Friseurin Betty Snopek und das Ehepaar Jablonski, Inhaber der Hofmöbelfabrik Reiss (Ecke Hauptstraße/Bienenstraße), die in der Pogromnacht im November 1938 von der SA verwüstet wurde. Nur drei von ihnen überlebten. Fünf weitere wurden bis 1945 aus anderen Orten deportiert.
Nach dem Krieg zerrieben sich viele der Überlebenden in langwierigen und demütigenden Entschädigungsverfahren. Erst viele Jahrzehnte später knüpften sie wieder an alte Kontakte an. Max Rubinstein, Norman Geffner und Benno und Regina Lustmann und viele andere besuchten – eingeladen von der Stadt – den Ort, mit dem sie ambivalente, schreckliche, aber auch positive Erinnerungen verbanden. Sie begegneten alten Freunden. Und schlossen neue Freundschaften.
RNZ Heidelberger Nachrichten vom Samstag, 27. Oktober 2018, Seite 6
2017
Rezension 2017/18
Das Sozialistische Patientenkollektiv Heidelberg
Christian Pross (unter Mitarbeit von Sonja Schweizer und Julia Wagner): „Wir wollten ins Verderben rennen.“ Die Geschichte des Sozialistischen Patientenkollektiv Heidelberg1970 – 1971. Psychiatrie Verlag, Köln 2016, 504 Seiten, 39,95 € (veröff. In Heidelberg – Jahrbuch zur Geschichte der Stadt 2018. Jahrgang 22. Herausgegeben vom Heidelberger Geschichtsverein. Kurpfälzischer Verlag (erscheint im November 2017)
Fast ein halbes Jahrhundert nach dem Auf-und Abtauchen des Sozialistischen Patientenkollektivs (SPK) an der Heidelberger Universität 1970/71 füllte sich Anfang November 2016 der Hörsaal 13 der Neuen Universität bis auf den letzten Platz. Eingeladen hatte der renommierte Psychiatrie-Verlag zur Vorstellung einer Untersuchung des Medizinhistorikers Christian Pross über das Sozialistische Patientenkollektiv (SPK), das von Ende Februar 1970 bis Mitte Juli 1971 an der Universität Heidelberg bestand. Schon der Titel von Pross` Buch ist irritierend: „Wir wollten ins Verderben rennen.“ Die eher beiläufige Aussage eines der 63 Zeitzeugen, die Pross und seine Mitarbeiterinnen interviewten, bringt das schon damals Verstörende am SPK auf den Punkt.
Entstanden war das SPK 1969/70 aus Therapiegruppen an der psychiatrischen Poliklinik, die seit 1968 auf Initiative des Arztes Dr. Wolfgang Huber existierten. Moderne therapeutische, gruppendynamische und von der Antipsychiatrie beeinflusste Ansätze kollidierten indes mit den zunehmend kämpferisch-radikalen Positionen Hubers innerhalb der Klinik. Nach seiner Entlassung Anfang 1970 wurde das SPK zu einer regelrechten „Massen“bewegung (über 500 Patienten), erhielt auf Betreiben des liberalen Uni-Rektors Rolf Rendtorff Räume in der Rohrbacher Straße und durchlief mit maximaler Beschleunigung einen (auch selbstzerstörerischen) Radikalisierungsprozess. Die zentrale Parole „Aus der Krankheit eine Waffe machen“ war zur wortwörtlich genommenen Handlungsanleitung geworden. Huber wurde am 25.6. 1971 nach einer spektakulären Polizeiaktion in Wiesenbach, bei der ein Polizist angeschossen wurde, verhaftet und mit anderen SPK-Aktiven zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Kontakte zur RAF bestanden, waren aber für das SPK nicht konstitutiv.
Pross versucht, die inneren und äußeren Wege des SPK in den hoch verdichteten Monaten seiner Existenz einzufangen. Mit zahlreichen Dokumenten, dem üppigen Schriften- und Flugblätterbestand, Statements von Zeitgenossen und Ex-Patienten, die zusammengenommen nicht immer ein kohärentes Bild ergeben. Alles am SPK war hypertheoretisch, aggressiv-zugespitzt, maximal radikalisiert, aber eben auch mehr als das. Ein Unterstrom von bedingungsloser Zuwendung zu den Patienten, von durch und durch legitimer Psychiatriekritik und insbesondere die Infragestellung der Patient-Arzt-Hierarchien sind sichtbar, auch wenn die therapeutische Praxis haarsträubend war. Daneben bedienten die Protagonisten des SPK alle öffentlichen Stereotypen gegen Linke und linke Radikale bis hin zur respektlos-fäkalisierenden Sprache, die auch da Distanz schaffte, wo wohlmeinend-solidarische Unterstützung angeboten wurde.
Der Autor Pross gehörte damals, was seine Position wissenschaftlich erschwert, aber eine authentische Innensicht ermöglicht, als Heidelberger Medizinstudent – entsetzt von eigenen Studiums-Erfahrungen in Psychiatrischen Krankenhäusern – zum inneren Kreis des SPK. Er reflektiert biographisch dieses unkritische und naive Solidaritätsintermezzo, an dessen Ende er von den SPK-Wortführern mit „Schimpf und Schande“ zum Teufel gejagt wurde. Sein Buch ist auch der Versuch, mit großem Abstand, aber erinnerungs- und erfahrungsgesättigt die fast kriegerischen Konfliktlinien aufzuzeigen, die das damalige Universitätsleben bestimmten. Mit all ihren Paradoxien und Widersprüchen. Rückblickend erscheint darin die Heidelberger Universitätspsychiatrie unter Prof. Walter Ritter von Baeyer als reformerischer Leuchtturm der Nachkriegspsychiatrie, auch wenn der konziliante Ordinarius von Baeyer die Konservativen und Reaktionäre in seiner Klinik weiter beschäftigte. Aber so wenig kompromissfähig Huber und sein Anhang waren, so wenig waren es die anderen Klinikdirektoren und vermutlich das ganze universitäre Establishment. Für diese waren Huber und sein Team Scharlatane, Hassprediger und sonstige Irre. Im Kampfkontext der Universität konnte ein neues Wahnbild entstehen: SPK, K(ommunistische)-Gruppen, die Linken und die Liberalen um Rektor Rendtorff – nichts als ein brandgefährliches Konglomerat, das es niederzuringen galt.
Im Kontrastprogramm dazu der an Karikaturen und Grotesken leider überreiche örtliche Linksradikalismus, von dem Huber nur eine Variante war. Ein Selfmade-Linker, der sich im Wochentakt radikalisierte. Der von Aus- und Abgrenzung zehrte, sich in der Retter-Attitüde stilisierte und mit einer Quirlmischung aus Hegel, Marx und Lenin seine Sicht aufs System zum Wahrheitsdogma aufzurüsten. „Krankheit ist Gesundheit in einer kranken Gesellschaft.“ Wird das in Krankheit verkapselte Potential entfesselt, entsteht revolutionäres Handeln. Denken kann man das. Vielleicht hilft es sogar, kurzzeitig. Schafft Solidarität, geistige Heimat, Geborgenheit. Für Patienten, die plötzlich Revolutionäre sein sollten, war es zerstörerisch und gefährlich. Die meisten, die Pross befragen konnte, sehen das genauso. Pross Text erinnert auch an jene, die daran zerbrochen sind.
Was Pross auch rekonstruiert, ist die von heute aus gesehen schier unfassliche Bereitschaft, dem SPK Arbeits- und Wirkungsbedingungen zu schaffen. Vom Verwaltungsrat der Universität bis zu einzelnen Hochschullehrern, von Prominenten wie Prof. Horst Eberhard Richter („Die Gruppe“), Prof. Peter Brückner, und Unterstützern vor Ort wie Dr. Dieter Spazier und Jörg Bopp (Initiatoren und Leiter der psychotherapeutische Studienberatung) und natürlich Rektor Rolf Rendtorff reichten diese Initiativen. Auch linke Gruppen, anfangs sogar der SDS durch Thomas Ripke, versuchten, auf das SPK einzuwirken. Psychische Not und Therapiebedarf waren doch überdeutlich und drängend. Warum nicht einen schützenden Fokus gewährleisten? Rettungsversuche, die die SPK-Aktivisten gewöhnlich mit Häme, Spott und triefendem Hass abfertigten. Und die für das Kartell aus Kultusministerium, Ordinarien und schriller Lokalpresse nur ein weiterer Anlass waren, dem Spuk ein Ende zu bereiten.
Noch eine Tiefenschicht ließe sich aus Pross` Untersuchung destillieren: Das universelle Umkippen von Kritik, Solidarität und Mitleiden in Gewaltphantasien, Feindschaft und Krieg. Der Aufstieg eines Milieus aus Sekten und Zirkeln, in denen der moderne Populismus ebenso gedeiht wie der alte Kadertyp. Das SPK erscheint als Menetekel, wie aus einer kreativen Studentenbewegung Hardcore-Kader entstanden, die – nach einer Sentenz von Marx – die Tragödien der Geschichte nochmals als Komödien nachspielen. Und dadurch eine historisch wertvolle, innovative Bewegung zugrunde richteten. Ja, Heidelberg hätte damals schon ein Ort sein können, in dem Hochschule und Gesellschaft Fortschritte gemacht hätten. So wie es später die Bürgerinitiativen, kulturelle und lebensreformerische Bewegungen und engagierte Einzelne praktiziert haben.
Um 1970/71 standen die Zeichen dagegen auf Sturm. Erfolge wie eine Rote-Punkt-Aktion machten misstrauisch und weckten den Verdacht, man habe mit dem Feind kooperiert. Wer den Diskurs verweigerte, hatte Recht. Wenn die Wirklichkeit nicht will, muss man sie zwingen und biegen. Huber und das SPK standen damit nicht allein, sondern verkörperten die fatale Zuspitzung eines von heute aus gesehen grotesken Mainstreams in dieser doch vorwiegend akademischen Revolte. Wer die 460 Textseiten von Christian Pross´ Untersuchung bewältigt hat, mag Trauer und Bedauern spüren über die damals vertanen Chancen. Oder froh sein, dass die Geschichte nicht 1971 endete.
Rhein-Neckar-Zeitung 12.01.2015
siehe auch Presse
2016
Die Kriegsgefangenen von Heidelberg
Im Ersten Weltkrieg wurden Soldaten aus den „Feindnationen“ in der Stadt als Arbeiter eingesetzt – Keine Übergriffe der Bevölkerung
Von Norbert Giovannini
Heidelberg. Im Frühjahr 1915 hatte man es auch in Heidelberg begriffen. Aus dem Viermonatsprojekt Krieg war eine Dauerkatastrophe geworden. Millionen junger Männer waren an der Front, die in den Tageszeitungen veröffentlichten Verlustlisten wurden immer länger. Lazarette und Kliniken in der Medizinerstadt Heidelberg füllten sich mit Schwerverwundeten. Die Dörfer im Umland hatten längst Kriegsgefangene angefordert, sonst wäre die Landwirtschaft zusammengebrochen. Überall fehlten Arbeiter: in Werkstätten, Betrieben, bei den Stadtwerken. Deshalb forderte auch Heidelbergs Stadtverwaltung Kriegsgefangene an. Aus dem rasch errichteten, riesigen Rastatter Kriegsgefangenenlager wurden am 29. April 1915 im ersten Schub 60 Gefangene nach Heidelberg transportiert. Untergebracht wurden sie im städtischen Bauhof gegenüber vom Schlachthof und dem heutigen HSB-Depot, mit Wachpersonal und Kantine, für die Gastwirt Pfefferle verpflichtet wurde.
Die Gefangenen kamen aus allen „Feindnationen“, die größte Gruppe aber waren Soldaten der zaristischen russischen Armee. Russen, Ukrainer, vielleicht Polen und junge Männer aus dem Baltikum. Zur Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs gehört das zuvor nie gekannte Ausmaß an Kriegsgefangenen, in Europa insgesamt zwischen 7 und 8,5 Millionen, davon allein dreieinhalb Millionen russische Soldaten und Offiziere. Im Chaos der ersten Kriegsmonate wurden sie in Lager gesperrt, dann aber in allen Krieg führenden Ländern außer England zügig in die Produktion geschickt – oft unter mörderischen, erbärmlichen Bedingungen in Bergwerken und der Großindustrie. Nur die Landwirtschaft, das Handwerk und städtische Betriebe boten bessere (Überlebens-)bedingungen.
Gefangene Offiziere waren von der Arbeit ausgenommen. In der 1913 fertiggestellten Neuen Infanteriekaserne am Kirchheimer Weg (Teil der späteren Patton Baracks) wurden etwa 100 französische, belgische, russische, britische und kanadische Offiziere unter relativ komfortablen Bedingungen untergebracht. Ein weiteres Lager, über das keine Unterlagen vorliegen, wurde von der großherzoglichen Eisenbahnverwaltung in den seit 1893 nicht mehr genutzten Epidemiebaracken eingerichtet. Eine andere Quelle spricht von einem militärischen Arbeitskommando mit 240 Gefangenen und 60 Wachleuten, Unterlagen gibt es dazu nicht mehr. Wir können aber von vier- bis fünfhundert Kriegsgefangenen in Heidelberg ausgehen.
Der Bedarf war reichlich vorhanden. Vor allem bei Handwerkern, die nach Spezialkräften verlangten, und Landwirten, die dringend kräftige junge Männer brauchten. Auch die Stadtwerke, die Stadtgärtnerei und die Müllabfuhr waren nicht mehr ohne Kriegsgefangene zu betreiben. Zum Kasernenbau, zum „Krüppelheim“ und in das Gaswerk – in alle Richtungen rückten die Gefangenen frühmorgens aus.
Kontakte mit der Bevölkerung waren verboten, Kosten und Entlohnung trugen Stadt und Arbeitgeber. Das Militärkommando zahlte den Gefangenen ein karges Entgelt in Scheckmarken. Keinesfalls sollten sie freie Einkäufe außerhalb des Lagers tätigen können, nur in Lagerkantinen und -verkaufsstellen. Zu kaufen gab es nur „einfachste Nahrung- und Gebrauchsgegenstände, keine Kuchen, Schokolade(n), Zuckerwerk und Leckerwaren… Tabak ist gestattet“.
Bemerkenswert ist, dass keine Übergriffe und Beschimpfungen durch die Bevölkerung dokumentiert sind. Im Gegenteil: Stadt und Arbeitgeber dachten über Weihnachtsfeste und bescheidene Geschenke für die Gefangenen nach. Das Tiefbauamt klagte, dass die 20 russischen Gefangenen, die beim Kanalbau des „Krüppelheims“ eingesetzt sind, in der Frühstücks- und Vesperpause nichts zu essen haben und „zusehen müssen, wie es sich unsere heimischen Arbeiter schmecken lassen. Deshalb Bitte um kleine Verköstigung und die Kosten auf den Baukredit der betreffenden Arbeit zu verrechnen“. Militärverwaltung und Regierung registrieren misstrauisch die „Vertrauensseligkeit der Bevölkerung“ und andere menschliche Zuwendungen, die vor allem dort entstanden, wo die Gefangenen Teil der bäuerlichen Hofgemeinschaft waren oder Lebensmittel zugesteckt bekamen. Offenbar wurde auch manchen zur Flucht verholfen. 1918 appellierte das Bezirksamt dringlich, die für Vogelscheuchen benutzten Kleidungsstücke so zu bearbeiten, dass sie als Männerbekleidung unbrauchbar sind.
Wir müssen vermuten, dass einige der in Heidelberg stationierten Kriegsgefangenen hier gestorben sind und auf dem neu geplanten städtischen Friedhof im Neuenheimer Feld bestattet wurden. Nach Kriegsende verwehrte die russisch-bolschewistische Regierung die Rückführung der in Deutschland inhaftierten russischen Soldaten, ebenso die Repatriierung der Gefallenen. So wurden viele, die den Krieg überlebten, an den Grenzen zu Russland ausgesetzt. Und die Toten blieben hier begraben und wurden – auch das eine paradoxe Fußnote der Geschichte – 1934 auf das Gelände des Ehrenfriedhofs umgebettet (siehe Artikel unten).
Fi Zum Weiterlesen: Norbert Giovannini: Heidelberg im Ersten Weltkrieg. Russische Soldatengräber, Lager und Kriegsgefangene im Arbeitseinsatz. Jahrbuch des Heidelberger Geschichtsvereins 2015.
Heidelberger Nachrichten vom Dienstag, 8. November 2016, Seite 29 (5 Views)
Wie kamen die russischen Soldaten auf den Ehrenfriedhof?
1934 wurden 24 Gefallene des Ersten Weltkriegs vom Neuenheimer Feld auf den Ameisenbuckel umgebettet – Gedenken am Volkstrauertag
Von Norbert Giovannini
Altstadt. Am diesjährigen Volkstrauertag am Sonntag, 13. November, gedenkt die Stadt auf dem Bergfriedhof einer längst vergessenen Gruppe von Toten aus dem Ersten Weltkrieg. Denn auf dem Ehrenfriedhof sind 24 russische Soldaten begraben. Warum liegen sie dort? Wie sind sie nach Heidelberg gekommen? Und warum sind ihre Gräber hier geblieben, auf einem Friedhof, der erst 1934, im zweiten Jahr der Naziherrschaft, eröffnet wurde?
Auf dem achsensymmetrisch angelegten Gelände auf dem Ameisenbuckel, der zur Altstadt gehört, stehen linker Hand der 28 Blöcke aus rotem Sandstein mit 2132 Namen gefallener Heidelberger Grabkreuze mit russischen Namen. Offenbar gehören sie zu in Heidelberg verstorbenen russischen Kriegsgefangenen. Auf dem jüdischen Friedhof beim Bergfriedhof gibt es noch zwei weitere Gräber von Soldaten, ursprünglich sollen es einmal fünf gewesen sein.
Das Stadtarchiv bewahrt die Sterbeanzeigen der Heidelberger Lazarette und Klinken. Nur deshalb wissen wir etwas mehr über diese Toten, etwa, wo sie gestorben sind. In 14 Fällen ist es das Lazarett in der Landhausschule, in fünf Fällen das Akademische Krankenhaus in Bergheim. Zu einem Toten gibt es keine Angaben, einer ist im Lazarett der Psychiatrischen Klinik gestorben. Wahrscheinlich waren sie Kriegsgefangene, die in Heidelberg und Umgebung als Arbeitskräfte eingesetzt waren und hier in einem der Gefangenlager lebten. Eher unwahrscheinlich ist, dass sie von der Ostfront zur medizinischen Behandlung hierher transportiert wurden.
Die beiden Jüngsten sind mit 23 Jahren gestorben, der Älteste war 45. Alle sind als einfache Soldaten ausgewiesen. Es sind überwiegend Söhne von Bauern, aus Dörfern und kleinen Städten, neun von ihnen waren verheiratet. Die in Bürgerkriegswirren verstrickte bolschewistische Regierung unternahm nach dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk, der am 3. März 1918 unterzeichnet wurde, und auch später nichts, um Kriegsgefangene oder Tote zurück nach Russland zu holen. Von deutscher Seite wurde auch eher gebremst – man brauchte die Gefangenen weiterhin als Arbeitskräfte.
Doch wie kamen diese russischen Soldaten auf den Ehrenfriedhof? 1913 hatte der Heidelberger Gemeinderat beschlossen, einen zentralen städtischen Friedhof auf dem heutigen Tiergartengelände anzulegen. Dort wurden ab 1914 allerdings ausschließlich Soldaten begraben, die im Ersten Weltkrieg in Heidelberger Lazaretten gestorben waren. Weil sich der Grundwasserspiegel infolge der Kanalisierung des Neckars hob, war der Friedhof bald Makulatur. Zwischen 580 und 600 Soldaten waren dort bereits begraben, darunter etwa 100 ausländische, die nach und nach in ihre Heimat überführt wurden.
Bereits 1932 bestanden Pläne für einen „Ehrenfriedhof“. Dorthin sollten die im Neuenheimer Feld Beerdigten überführt werden. Beteiligt war der Architekt Paul Bonatz, dessen Bahnhofsgebäude in Stuttgart gerade abgerissen wird. Im Mai 1933 beschloss der Gemeinderat ein noch mehr heroisierendes, militaristischeres Gestaltungskonzept mit, in dem auch das Kreuz durch einen monolithischen Altar mit ausgemeißeltem Hakenkreuz ersetzt wurde. Im Oktober 1934 erfolgte dann die Überführung der Soldatengräber auf den Ehrenfriedhof – in einem mehrstündigen Zug durch die Stadt, begleitet von Trommelwirbel, vaterländischen Reden und düsterem Zeremoniell. Es folgten kriegerische Gedenkfeiern des Wehrverbandes „Stahlhelm“ und nicht weniger kriegerische Weihefeiern der Heidelberger Kirchen.
Auch die russischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg wurden nach oben gebracht, die Särge mit der Reichskriegsflagge bedeckt. Die als „Helden-Gedächtnisblatt“ 1934 in den Tageszeitungen veröffentlichte Belegliste unterschlug allerdings die russischen Soldaten – so konnte in den weihevollen und blutrünstigen Festreden der Anschein erweckt werden, dass hier ausschließlich deutsche Soldaten liegen. Wir können nur spekulieren, warum die NS-Machthaber 1934 diese 24 russischen Soldaten – so makaber die Überführung inszeniert war – mit auf „ihren“ Ehrenfriedhof umbetteten. Vielleicht war es ein letzter Funke des Respekts vor ehemaligen Kriegsgegnern oder wenigstens vor militärischen Traditionen. Vielleicht auch nur die Sorge, dass irritierte Heidelberger nachfragen würden, wo denn die Russengräber geblieben seien.
Heidelberger Nachrichten vom Dienstag, 8. November 2016, Seite 29 (4 Views)
Siehe auch Presse
2015
Oktoberdeportation 1940
Am 22.Oktober 2015 jährt sich zum 75. Mal ein Ereignis, das als Oktoberdeportation 1940 in die Geschichte eingegangen ist.
„Wir sind noch im Bett. Nur Mutti ist auf. Es ist halb acht Uhr. Plötzlich höre ich unbekannte Männerstimmen bei uns im Flur, und dann verstehe ich, was sie vorlesen. „Sie haben innerhalb einer Stunde am Bahnhof zu sein. Pro Person sind 50 Kilo Gepäck erlaubt. Verpflegung für vier Tage.“ .. Ich bin ganz erstarrt, springe aus dem Bett und ziehe mich in fliegender Eile an, dicke Wäsche. Unten steht ein Polizist, der niemand raus und rein lässt. Jeder wirft in den Koffer, was er gerade findet. Das Hausmädchen von E. nimmt einen Korb mit frischgewaschener Wäsche, geht damit zur Tür hinaus und sagt zum Polizisten: „Die gehört mir!“
Die 18jährige Miriam Sondheimer beschreibt den Tag der Deportation der badischen und pfälzischen Juden am 22. Oktober 1940. Sie wohnte mit Schwester, Eltern, Großeltern und weiteren 25 Personen in der Bunsenstraße 19 a. Die Oktoberdeportation 1940, ein Ereignis, das sich in diesem Jahr zum 75. Mal jährt. 6500 Menschen aus 186 badischen, 93 pfälzischen und 17 saarländischen Orten wurden in einer wochenlang geplanten Aktion in neun Sonderzüge gepfercht und nach Frankreich transportiert. Die erste und einzige Deportation nach dem Westen. In Panik verfolgen die Menschen in den Zügen die Richtung, in die sie fahren. Nach Osten, das sind die gefürchteten Lager im Osten Polens, das „Schutzgebiet“ Lublinland, das nach Kriegsbeginn mit Zehntausenden von Juden aus Westpolen und Österreich gefüllt wird. Oder nach Westen, ins unbesetzte, aber mit den Deutschen kollaborierende Vichy - Frankreich. Nach drei Tagen und vier Nächten halten die Züge in Oléron St. Marie, einem kleinen Ort am Rand der Pyrenäen in Südfrankreich, nahe der spanischen Grenze. Bei strömendem Regen werden die erschöpften Menschen in das Lager Gurs gefahren. Kein Konzentrationslager. Seit 1939 ein Fluchtort für spanische Bürgerkriegsflüchtlinge. Mit der Westoffensive aber auch Lager für französische, belgische, holländische Juden und jüdisch-deutsche Flüchtlinge. Für die meisten der Beginn eines Martyriums, das in Auschwitz und anderen Tötungslagern im Osten endet. Für manche, so auch für Miriam Sondheimer, ihre Schwester Lore und die Eltern und Großeltern, ein Durchgangsort ins Exil. Schon Mitte Februar können sie das Lager verlassen, im Mai sind sie in Lissabon und fliehen in die Dominikanische Republik.
Aus Heidelberg deportiert wurden etwa dreihundert Menschen, dazu über hundert aus Umlandgemeinden. Unter ihnen die damals zehnjährige Ruth Hamburger aus Malsch, die zum Schulbesuch in Heidelberg wohnte. Zwanzig Kinder und Jugendliche, die beiden jüngsten, Rolf Hirsch und Anna Erfurth, sind vier Jahre alt.
Überwiegend aber sind es ältere Menschen, viele Alleinstehende, Kranke und Greise. Im ersten bitterkalten Winter sterben 800 der Deportierten. Unter ihnen die über 80jährigen Barbara Seligmann, Bertha Hoffmann und Robert Drexler aus Heidelberg.
Das Lager ist ein Schlammloch, die Baracken kaum heizbar, man schläft auf dem Boden auf Strohsäcken, keine Medizin, beißender Hunger und pure Verzweiflung. Das Lager, etwa so groß wie Heidelberger Altstadt, ist in Barackenkomplexe getrennt, von Stacheldraht umsäumt, Männer und Frauen getrennt, Familien zerrissen. In den Baracken drängen sich 60 Gefangene, beim Gang zur offenen Latrine versinkt man im Schlamm. Zu Angst, Hunger und Verzweiflung gesellt sich der Verlust jeder Privatheit, der Geborgenheit der eigenen vier Wände. Die Zustände erniedrigen und zerstören, selbst dort, wo die Bedingungen mit denen der Todeslager im Osten nicht vergleichbar sind. Nur langsam laufen die internationalen Hilfsaktionen an. Das Schweizer Rote Kreuz, die englischen Quäker, das protestantische Comité inter mouvements auprès des évacués (Cimade), die Baden-Pfalz-Hilfe, die der Heidelberg Arzt Willy Braunschweig mit seiner Frau Clara 1940 in Frankreich gründeten, werden aktiv. Rabbiner Anspacher gründet im Lager eine Commission Centrale d`Assistance, zur umfassenden Hilfe bei Ausreise und im Alltag. Ein unvorstellbares kulturelles Leben mit Konzerten, Lesungen und Theater entsteht. Man lernt Fremdsprachen, korrespondiert, knüpft Beziehungen nach draußen. Und forciert das religiöse Leben. Gottesdienste unter freiem Himmel mit mehreren tausend Teilnehmern finden satt, Beträume werden in den Baracken eingerichtet. Ein verzweifelter Kampf um Würde, Achtung und Überleben.
Die Oktoberdeportation war von „ganz oben“, von der Partei- und Staatsleitung abgesegnet. Initiatoren waren die beiden ehrgeizigen Gauleiter Robert Wagner (Baden/Elsass) und Joseph Bürckel (Saarpfalz und Lothringen), die sich brüsteten, mit dieser Aktion ihre Territorien „judenrein“ gemacht zu haben. „Reibungslos“, wie sie nach Berlin meldeten. Eine Generalprobe für viele nachfolgende Deportationen aus dem sogenannten Altreich. Keine Proteste der Bevölkerung, alles ordentlich organisiert, funktionierende Verwaltung und Polizei. Dazu das Vermögen der Juden beschlagnahmt, enteignet und alsbald mit gutem Ertrag und großem Interesse der Bevölkerung versteigert. Nach der Pogromnacht 1938 waren in den Städten die Juden „entmietet“ und in Judenhäuser eingewiesen worden. In Heidelberg die Landfriedstraße 10, die Bergheimer Straße 25, die Bluntschlistraße 4 und einige Adressen in der Weststadt. Andere hatten Unterschlupf gefunden bei Hausbesitzern, die vom Mischehenstatus geschützt waren wie Else und Paul Hirsch in der Happelstraße 15. Das erleichterte den Behörden den Zugriff. Nur Schwerstkranke wurden nicht mittgenommen. Eine Chance für Hermann Maas, den Pfarrer von Heiliggeist, und seinen kleinen Unterstützerkreis, einige zu retten, indem sie durch schnell beschaffte Medikamente zum Transport unfähig gemacht wurden.
Im Oktober 1940 waren in Partei und Staat noch Überlegungen aktuell, die europäischen Juden in Madagaskar oder anderswo anzusiedeln. Oder sie zur Emigration zu drängen. Daher gab es einmal die Chance, Gurs zu entkommen, wenn man Papiere beschaffen, Einreisegenehmigungen erwerben und Transferkosten bezahlen konnte. Gurs bot außerdem bis 1942 die Chance, mit Hilfe kirchlicher und caritativer Organisationen irgendwo in Frankreich unterzutauchen. Kinder wurden in Kinderheime vermittelt, alte Menschen in Altersheime, Arbeitsstellen außerhalb des Lagers boten vorübergehend Unterschlupf.
54 der Deportierten aus Heidelberg gelangen Flucht und Emigration (darunter 40 in die USA, vier nach Palästina54), 37 überlebten in Frankreich. Erst ab Frühjahr1942 waren die Auswanderungskanäle verschlossen. Das NS-Regime hatte die „Endlösung“, Massenmord in den Vernichtungslagern im Osten, beschlossen. Seit Mitte 1942 rollten die Deportationszüge aus Frankreich nach Auschwitz. Die Gurs-Insassen wurden auf andere Lager verteilt und auf Umwegen nach Paris transportiert: In den Biographien der Heidelberger tauchen die Lager Masseube, Récébédou, Nexon, Noé und das unfasslich brutale Lager Rivesaltes als Zwischenstationen auf.
Zu den fünfzig in Gurs gestorbenen Heidelbergern kamen noch weitere 30, die diese Lager nicht überlebten. Endpunkt der Transporte war die monströse Polizeikaserne Drancy bei Paris. Von dort aus führen am 6., 8., 24. August und 1. September 1942, sowie am 27. Februar und 3. März 1943 die Transporte der badisch-pfälzischen Gurs-Insassen, fast alle direkt nach Auschwitz. Mindestens 87 der Heidelberger sind in Auschwitz getötet worden, 35 in anderen Konzentrationslagern. Fast hätte der junge Hans Oppenheimer überlebt. Mit 19 Jahren nach Gurs deportiert, von dort aus an Arbeitsstellen außerhalb des Lagers vermittelt, im August 1942 über Drancy nach Auschwitz gebracht. Im Frühjahr 1945 aus Auschwitz in das Lager Blechhammer, von dort auf einen der Todesmärsche in den Westen gezwungen, verstarb er am 17. März 1945 in Buchenwald, wenige Tage vor der Befreiung dieses Lagers.
Rositta Oppenheimer, seine Mutter, erfuhr im März 1943 vom Abtransport ihres Mannes Leopold aus dem Lager Noé in das KZ Majdanek. Nach dem Krieg findet sie das Tagebuch und die Briefe ihres Sohns bei seiner letzten Arbeitsstelle auf einem Bauernhof. Nach Heidelberg zurückgekehrt, ist sie viele Jahre Vorsitzende der jüdischen Nachkriegsgemeinde und leitete das Jüdische Altersheim in der Villa Julius, die auf dem heutigen Gelände von Synagoge und jüdischem Kulturzentrums in der Häusserstraße stand. 15 Deportierte aus Heidelberg und Ziegelhausen kamen zurück, darunter der Antiquar Albert Carlebach und der Lehrer Ludwig Demuth. Miriam Sondheimer wanderte mit ihrer Schwester, den Eltern und der Großmutter 1946 in die USA aus. Großvater Adolf Kehr war von Ordensfrauen aus dem Lager Noé gerettet worden und ist 1944 in Frankreich gestorben. Von den Mitbewohnern der Bunsenstraße 19a sind neun in Auschwitz getötet worden, Familie Kahn konnte nach England emigrieren. Lange Jahre arbeitete Miriam Sondheimer im Leo-Baeck-Institut in New York. Mehrfach war sie mit ihrer Schwester Lore zu Besuch in Heidelberg. Ihre Lebenserinnerungen, teilweise publiziert, sind eine Fundgrube an Erinnerung über die Zeit im Lager Gurs.
Rhein-Neckar-Zeitung 22.10.2015
2014
Norbert Giovannini
Es ist der stillste Ort.
Der alte jüdische Friedhof vor dem Klingentor in Heidelberg
Es ist der stillste Ort, unscheinbar, übersehbar, wie damals, 1701, als in dem oft kalten und schattigen Tal hinter dem Klingentor den Heidelberger Juden ein aufgelassenes Grundstück als Friedhof überlassen wurde.
Ein Platz, der wie die kurfürstliche Regierung befand, „von der Stadt aus wenig und von der Kaserne aus gar nicht gesehen werden kann, an keiner Straße gelegen und sonst niemand hinderlich oder verdrießlich ist.“ (Löwenstein, 1895, S. 135)
1988 habe ich – aus Anlass einer Stadtführung zum Gedenken an die Pogromnacht 1938– diesen alten jüdischen Friedhof am Klingenteich erstmals wahrgenommen. Der Frankfurter Kantor und Lehrer Benno Szklanowski führte uns leise und kundig zu den damals schon beträchtlich verwitterten Gräbern, deren hebräische Inschriften er übersetzt, zum Teil rekonstruiert und nach ihren biblischen Quellen dokumentiert hatte. Viele Führungen im Rahmen des Geschichtsvereins folgten, zu jeder Jahreszeit, für immer staunende Besucher, die das hinter einer Mauer versteckte, auch vom Graimbergweg herab nur schwer erkennbare Gelände nie zuvor betreten hatten.
Anfang der achtziger Jahre war das Gelände auf Anregung der jüdischen Hochschule gärtnerisch saniert worden. Ein Angestellter des Friedhofsamtes schenkte uns ein Foto, das den Zustand davor zeigte: Wildes Gestrüpp, umgestürzte Grabsteine, eine merkwürdige Hütte. Ein Luftschutzbunker sei während des Kriegs in das Gelände gegraben worden, Kinder hätten mit Knochen gespielt, die Mauern, vor allem die Stützmauern nach Osten waren mehrfach eingestürzt und hatten Grabstellen zerstört.
Ein mit den Emblemen von Taube und Sichel versehenes, immer verschlossenes Tor schützt den kleinen Friedhof, wuchtige Bäume beschatten ihn, die Nässe nagt an den weichen Buntsandsteinen, sprengt die Beschriftungen ab, diese sprachlich wuchtigen und zugleich fein ziselierten Zitat-Collagen, die Ornament und Gebet und Nachruf in einem sind.
„.. ich erhebe ein Totenlied und Klage auf den Bergen und auf den Feldern des Hermons und eine Stimme werde ich klingen lassen wie eine Glocke, es schwand dahin der Fromme von der Erde, ein Gerechter und Verteidiger des Streites des Volkes mit ehrlichen Gesetzen in Dotan und Heiman, vom Gebirge des Ostens werde ich die Stimme erheben über Benjamin, den Liebling Gottes, der in seiner Wärme und Geschmack ist wie eine Dattelpflaume..“.
Die kombinierte Poesie von Jeremia, Micha, Numeri und Exodus ist Inschrift auf dem ältesten noch vorhandenen Stein für den im Juni 1772 verstorbenen gelehrten Rabbi Benjamin Elchanan. (Stein Nr. 150) Wo sind die Steine aus den vorangegangenen siebzig Jahren?
Die im Bogenfeld rundlaufende Inschrift, fortgesetzt auf der langen, schlicht umrahmten Tafel, ohne weiteren Schmuck, in ist allen Facetten prototypisch für diese bescheidene Grabsteinkultur einer nicht sehr wohlhabenden jüdischen Stadtbevölkerung im ausgehenden 18. Jahrhundert. Gelegentlich finden wir einfache Schmuckelemente, Pinienzapfen, Fruchtgehänge, kleine Pyramiden und die symbolträchtigen Krüge, Kannen und Schüsseln, die den Toten in ein Abstammungsverhältnis zu den Leviten setzt; die erhobenen Hände, die eine acherontische, priesterliche Abstammung anzeigt.
Der Text selbst ist immer religiöse Biographie, bezeichnet Funktionen in der Gemeinde und für sie: Vorsteher, Steuereinnehmer, Musikmann, verbunden mit murmelnd anspielungsreichen und gelehrten Lobreden auf das religiöse Wirken der Verstorbenen, Todestag, Alter, Familienstand und rituellen Formeln. TNZBH – möge seine Seele eingebunden sein im Bündel des (ewigen)Lebens.
Manchmal ist es auch ein Ausflug in schlichte Prosa
„Hier ruht ein aufrechter und vertrauenswürdiger Mann, alle seine Lebenstage wandelte er schlichten Weges, er begab sich frühmorgens und abends in die Synagoge, Tag ein, Tag aus.“ (Stein Nr. 38 H.Feiss Carlebach).
Noch stärker bei Tetzche, der Tochter des Moses Carlebach.
„Die hübsche Jungfrau, unsere Tochter, gleich den Ecksäulen im Grabe, wohlgeformt, prachtvoll gebaut.“
Doch ist auch diese dezente Erotik exegetisch eingebunden (Psalm 144, 12 und Hohes Lied 4,4).
Ein Grabstein im unteren Segment des Friedhofs sticht heraus, auch wenn man ihn mittlerweile mühsam suchen muss. In der Form eine schmucklos-konventionelle Gesetzestafel, in der Beschriftung ein Bruch: deutsch, knapp, kein Schriftzitat, bürgerlicher Kalender.
„Hier ruht Salomon Riechheimer Sohn des Stiftungsrabbiners Löw Riechheimer dahier, fromm und aufrichtig war sein Wandel er starb am 29ten Mai 1821“ (Stein Nr. 56)
Eine Epochenwende wird sichtbar: Reformbewegungen im Judentum, die auch die kleine Gemeinde in der Universitätsstadt Heidelberg erfasst. Ein Jahrzehnte dauernder Konflikt, der die Gemeinden zu zerreißen droht: Eine Orgel in der Synagoge, Gebete in deutscher Sprache, Lehrbücher für Kinder, Zuwendung zur bürgerlichen Gesellschaft, den Wissenschaften, der Aufklärung.
Salomon Riechheimers Radikalität bleibt zunächst solitär. Kompromisse beherrschend die Grabsteingestaltung. Dank der Hanglage ist die Schauseite der Steine nach Westen gerichtet, statt nach Osten, wie es sein sollte. Also bleibt die Schauseite hebräisch und traditionell, einschließlich der Sterbedaten nach dem jüdischen Kalender. In manchen Fällen auch kombinierte Eintrage, hebräisch- deutsch. Mehr und mehr, vor allem nach dem ersten Anstieg im Gelände, das zu den Toten der dreißiger und vierziger Jahre führt, drängen die deutschen Inschriften und lateinischen Buchstaben auf die Schauseite, treten ornamentale und bildliche Variationen (bis zum reliefplastisch gemeißelten Kopf bei Johanna Kohn, Stein Nr. 92) in den Vordergrund, dazu abgebrochene Rundsäulen mit dekorativem Lorbeer (Stein Nr. 96). Ein Höhepunkt ist die aufwändig beschriftete Doppeltafel der Geschwister Mordechai Marx und Frumet Stern, 1845 im Abstand eines Monats verstorben, vorderseitig hebräisch, rückseitig deutsch, mit verbindender Balkenbeschriften unter den beiden Rundbögen: „..die lieb und hold im Leben auch im Tode nicht getrennt.“ ((Stein 81a)
In den oberen Feldern dominiert das bürgerliche, assimilierte Judentum des 19. Jahrhunderts, wenn auch mit konservativer Rückbindung an die Traditionen.
„Hier ruht Mina Loeffler, geb. Reckendorf. Eingegangen ins bessere Leben im 82. Lebensjahr. Der Menschheit dienen war ihre Freude.“ (Stein Nr. 124).
Ganz im Dickicht versteckt die Klage eines Ehemanns und Vaters.
„Hier ruhen die sterblichen Überreste meiner geliebten Gattin.. ihr folgte den 27. Juli unser 18 Tage altes Töchterchen.“ (Stein 148).
Wenige Schritte entfernt der opulente Grabstein des 45 Jahre amtierenden Rabbiners Salomon Fürst (mit Krone) und der eine Rundsäule umlaufende Klagegesang auf die 1874 verstorbene Aide Hessen aus Odessa.
„.. eine Frau, jung an Jahren, Mutter dreier Kinder, sie stieg ins Grab im Alter von 25 Jahren, Tochter eines ratlosen Vaters und einer weinenden Mutter, alle zusammen samt ihrem Gatten verließ sie plötzlich und erkrankte. Tränen wie ein Meer zerbrechen jedes Herz und aus schauendes Auge. Sie zog hinaus von ihrem Geburtsort Odessa und ihrem Vaterhaus Rones nach Heidelberg, der Ärztestadt, um Zuflucht zu suchen…“
Ein anrührender, ein verwirrender, ein die private Biographie exponierender Text, in der Form den ersten früheren Inschriften folgend, im Inhalt ein ziviles, bürgerliches Drama um Verlassen, Erkranken und Sterben.
180 Grabsteine waren in den achtziger Jahren noch vorhanden, viele davon sind inzwischen eingesunken, die Inschriften abgelöst. Die gärtnerische Neugestaltung hat die Steine für Besucher freundlich mit der Schauseite zum Weg hin gerichtet, den ältesten oben an der südlichen Grenzmauer gesetzt, die traditionellen Reihungen vermutlich durcheinander gebracht. Die Embleme von Taube und Sichel, die für Seele und Tod stehen, wurden 1991 erneuert.
Eine alte Geschichte sagt, dass die Stifterin des Friedhofs eine Täubche Sichel gewesen sei. Der Friedhof enthält viele dieser dunklen und hellen Geschichten und auf einige Höhenmeter verteilt die Geschichte der jüdischen Emanzipation im 19. Jahrhundert, an den Grabsteinen ablesbar.
1876 wurde der Friedhof geschlossen. Waren es die (vorgeschobenen) Ängste vor gefährlichen Leichendünsten, wie sie die zeitgenössische Miasmentheorie nahelegte, oder die Interessen der Bauherren entlang der Klingenteichstraße, die einen jüdischen Friedhof obsolet machten? Nach zähen Verhandlungen der jüdischen Gemeinde mit der Stadt konnte ein lang gezogener Geländeschal neben dem Bergfriedhof als neuer jüdischer Friedhof eingerichtet werden.
A. Cser: Zwischen Stadtverfassung und absolutistischem Herrschaftsanspruch (1650 bis zum Ende der Kurpfalz 1802). In: Peter Blum/Stadt Heidelberg (Hg.): Geschichte der Juden in Heidelberg. Buchreihe der Stadt Heidelberg Bd. 6. Heidelberg: Guderjahn 1996, S. 46 – 153, hier S. 60-62
S. Döhring: Die Geschichte der Heidelberger Juden (1862-1918). In: Peter Blum/Stadt Heidelberg (Hg.): Geschichte der Juden in Heidelberg. Buchreihe der Stadt Heidelberg Bd. 6. Heidelberg: Guderjahn 1996, S. 217-347, hier S.251-255
L. Löwenstein: Geschichte der Juden in der Kurpfalz: nach gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt. (Beiträge zur Geschichte der Juden in Deutschland, Bd. I) Frankfurt a. M. 1895
H.M. Mumm: Die jüdischen Friedhöfe. In: N. Giovannini, J. Bauer, H.M. Mumm (Hgg.): Jüdisches Leben in Heidelberg. Studien zu einer unterbrochenen Geschichte. Heidelberg: Wunderhorn 1992, S. 297-306
E. Mushake (Schriftleitung): Die Friedhöfe in Heidelberg. Führer durch die christlichen und jüdischen Friedhöfe. Frankfurt am Main 1930 (Franzmathes Verlag) (Nur antiquarisch. Enthält auch eine botanische Beschreibung des Friedhofgeländes)
B. Szklanowski: Der alte jüdische Friedhof am Klingenteich in Heidelberg 1702 bis 1876. Eine Dokumentation im Auftrag der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg. Reihe: Neue Hefte zur Stadtentwicklung und Stadtgeschichte 3/1984. (Angaben zu den Nummern der Steine sind diesem Buch entnommen)
http://www.alemannia-judaica.de/heidelberg_friedhofkling.htm